
„Politikdidaktische Prinzipien“ oder „Orientierungen“ lassen sich mit Bernhard Sutor als „grundlegende Handlungsregeln für die Planung und Lenkung von Unterricht definieren.“ (POHL 2004, S 322). Dabei wird deren Bedeutung und Stellenwert von Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktikern sehr unterschiedlich bewertet. Hinzu kommt, dass es zahlreiche fachdidaktische Prinzipien gibt. In dem Interviewbuch „Positionen der politischen Bildung 2“ werden zahlreiche Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktiker nach deren Meinung dazu befragt. Neben anderen sind hierbei die am häufigsten genannten didaktischen Prinzipien die Problemorientierung, die Schülerorientierung, die Handlungsorientierung, das exemplarische Lernen, die Konfliktorientierung, die Kontroversität und die Wissenschaftsorientierung. In einer Politikstunde sind nicht immer alle oder mehrere dieser Prinzipien vertreten, sondern sie werden je nach Thema sorgfältig ausgewählt und zielführend eingesetzt. Eine Auswahl fachdidaktischer Prinzipien...
POHL, KERSTIN (2004) (Hrsg.): Positionen der politischen Bildung 1. Ein Interviewbuch zur Politikdidaktik. Schwalbach/Ts.: Wochenschau.
POHL, KERSTIN (2016) (Hrsg.): Positionen der politischen Bildung 2. Interviews zur Politikdidaktik. Schwalbach/Ts.: Wochenschau.
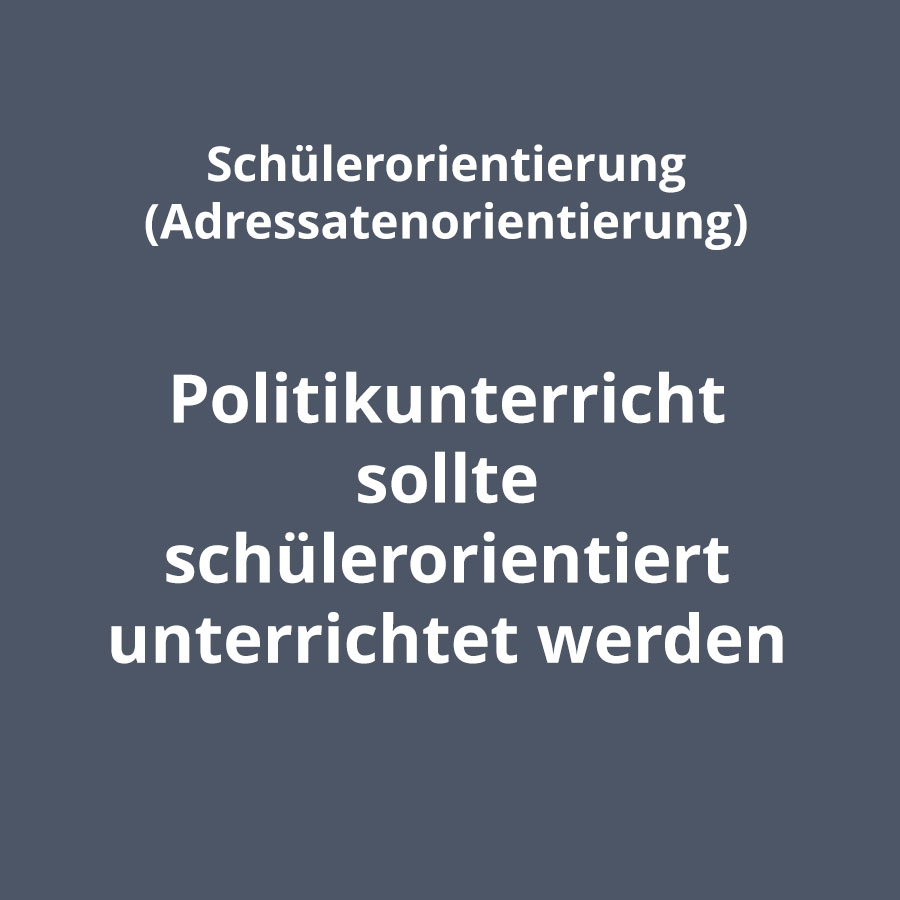
Was bedeutet das?
„Lerngegenstände sollten so ausgewählt und strukturiert werden, dass sie an das Vorwissen der SuS anknüpfen und sie sich im Politikunterricht ernst genommen sowie ihre Lebenserfahrungen und Lerninteressen berücksichtigt werden.“ (Vgl. SANDER, 2008, S. 191)
Drei Aspekte sind hierbei bedeutsam:
- Aus Sicht der Adressatenorientierung muss Unterricht so gedacht und geplant werden, dass den Lernenden Kompetenzzuwächse ermöglicht werden und weniger von dem im Vordergrund steht, was der Lehrende aus seiner Sicht auf die Sache für wichtig hält.
- Der Unterricht muss sich auf die sehr unterschiedlichen Lerninteressen der Schülerinnen und Schüler einlassen und differenzierte Lernangebote bereithalten. Dies verlangt eine Offenheit für die Frage nach dem Nutzen für die Lernenden.
- Der adressatenorientierte Unterricht soll, wo immer es möglich und sinnvoll ist, eine Beteiligung von Schülerinnen und Schülern bei der Planung und während des Verlaufs des Lernvorhabens zulassen. (vgl. ebd., S. 191f.)
SANDER, WOLFGANG (2008): Politik entdecken – Freiheit leben. Didaktische Grundlagen politischer Bildung. 3. durchgesehene Auflage. Schwalbach/Ts.: Wochenschau.
Was bedeutet das?
„Lerngegenstände sollten so ausgewählt und strukturiert werden, dass an konkreten politischen Einzelbeispielen verallgemeinerbare Erkenntnisse über Politik gewonnen werden können.“ (SANDER 2008, S. 193)
Dieses aus der Allgemeindidaktik abgeleitete Prinzip ist v.a. eine Antwort auf die immense Zunahme von Wissen in sämtlichen Fächern und Wissenschaften und auf die fortschreitende Differenzierung innerhalb der Wissenschaften (vgl. ebd.).
„Exemplarisches Lernen ist mehr als, wie es vom Begriff her zunächst erscheinen könnte, ein Lernen an illustrativen Beispielen. Zwar soll an `Beispielen` gelernt werden, aber in einem ganz bestimmten Sinn: nicht als bloße Veranschaulichung (...) und nicht als bloßer `Einstieg` in einen ansonsten fachsystematisch strukturierten Lehrgang, sondern als gründliche, ein Lernvorhaben (oder zumindest einen thematischen Zusammenhang innerhalb eines breiteren Vorhabens) strukturierende Auseinandersetzung mit einem typischen Beispiel, an dessen Analyse Wissen und Erkenntnisse erworben werden können, die auf eine Vielzahl anderer, ähnlich gelagerter Gegenstände im Sinn von Transferlernen übertragbar sind. Solche Beispiele können etwa aktuelle Fälle, Konflikte oder konkrete politische Probleme sein.“ (ebd. S. 193f.)
SANDER, WOLFGANG (2008): Politik entdecken – Freiheit leben. Didaktische Grundlagen politischer Bildung. 3. durchgesehene Auflage. Schwalbach/Ts.: Wochenschau.
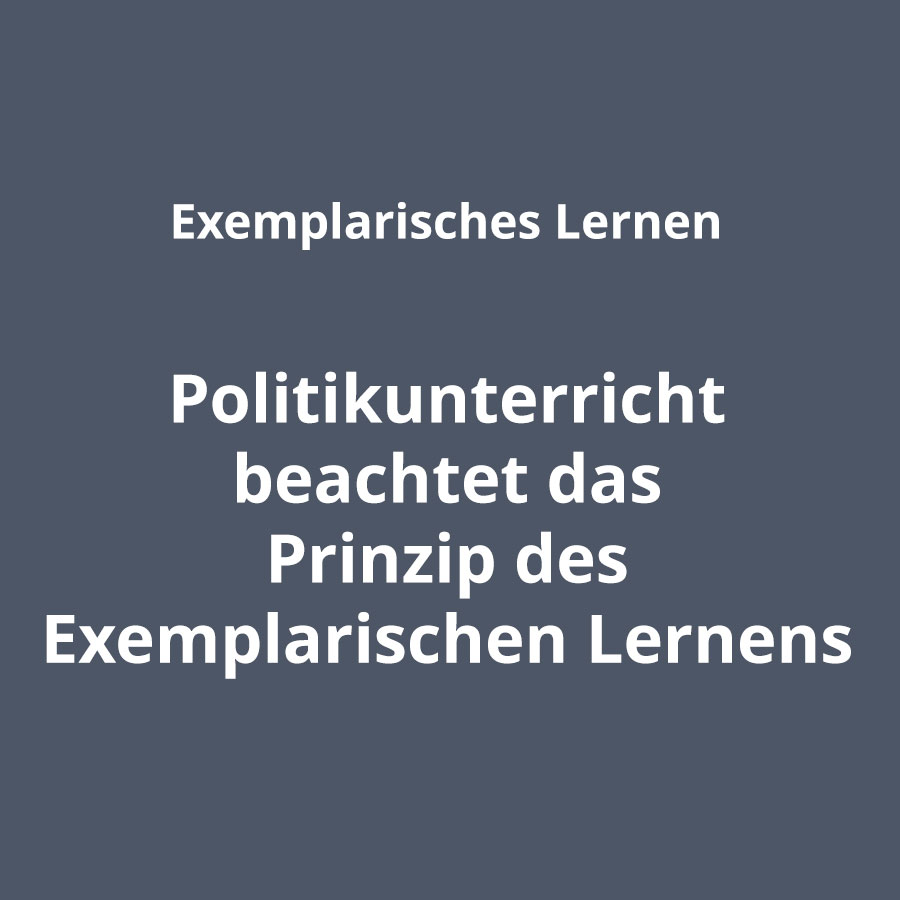
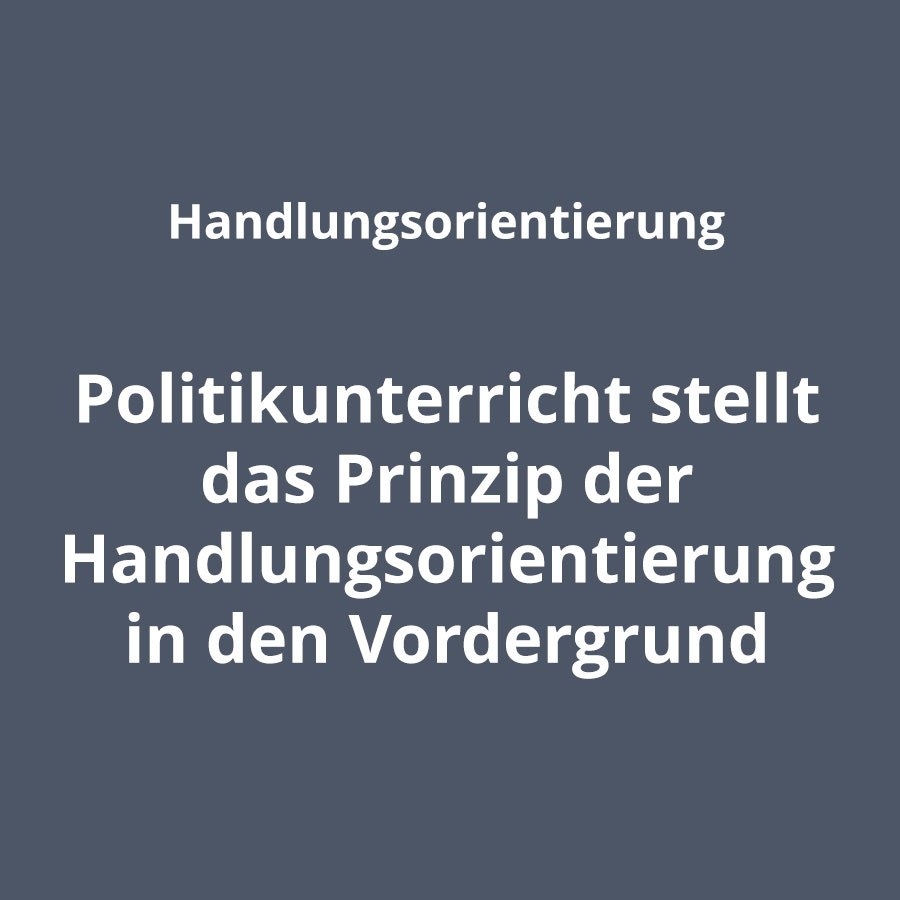
Was bedeutet das?
„Lerngegenstände sollen in Lernsituationen so thematisiert werden, dass die Lernenden vielfältige Gelegenheiten zu einem aktiv-handelnden Umgang mit ihnen erhalten.“ (SANDER 2008, S. 198)
Im Unterschied zum lehrerzentrierten Unterricht, der den Schülerinnen und Schülern eine äußerlich bloß rezeptive Rolle zumutet, versetzen handlungsorientiert gestaltete Lernvorhaben die Lernenden in aufgabenhaltige Situationen, die sie durch eigene Aktivitäten bewältigen müssen (vgl. ebd., S. 199). Er dient der Befähigung zur Partizipation (Handlungskompetenz). Eine Präzisierung des Begriffes „Handeln“ kann mithilfe dreier Dimensionen erfolgen:
- Im handlungsorientierten Politikunterricht ist die Tätigkeit des lernenden Subjekts lebendig, aktiv und selbstbestimmt und betont nicht nur das kognitive Arbeiten, sondern auch die Emotionen und das praktische Tätigsein.
- Der handlungsorientierte Politikunterricht betont, dass Lernen nicht nur in der Schule stattfindet, sondern dass die Orte des Lernens das gesamte Leben umfassen.
- Im handlungsorientierten Politikunterricht wird sich gemeinsam über Ziele, Verfahren und Inhalte verständigt (vgl. REINHARDT, 2005, S. 106).
„Handlungsorientierter Unterricht meint also ganzheitliches, wirklichkeitsnahes und demokratisches Lernen.“ (REINHARDT, 2005, S. 107).
REINHARDT, SIBYLLE (2005): Politik-Didaktik. Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II. Berlin. Cornelsen Scriptor.
SANDER, WOLFGANG (2008): Politik entdecken – Freiheit leben. Didaktische Grundlagen politischer Bildung. 3. durchgesehene Auflage. Schwalbach/Ts.: Wochenschau.
Was bedeutet das?
„Dominierte in den 1950er Jahren ein soziologisches Denken, das auf die Erklärung des ‚reibungslosen Funktionierens von Gesellschaften‘ gerichtet war, so hob der damals in Konstanz lehrende Sozialwissenschaftler Ralf DAHRENDORF 1961 die ‚beharrliche Tatsache sozialer Konflikte‘ hervor. Das fachdidaktische Korrelat dazu hat Hermann Giesecke [...] geliefert. Im Blick auf Widersprüche bzw. die Auseinandersetzung zwischen Menschen und Gruppen leitete er 1965 elf ‚Kategorien‘ ab: Konflikt – Konkretheit – Macht – Recht – Funktionszusammenhang – Interesse – Mitbestimmung – Solidarität – Ideologie – Geschichtlichkeit – Menschenwürde.
GIESECKES Konzept steht damit für die Überwindung der bis dahin dominierenden ‚Institutionenkunde‘. Es beruht auf vier Annahmen:
- Konflikte sind das entscheidende Definitionsmerkmal des Politischen,
- Konflikte fungieren als Prinzip der Inhaltsauswahl für den Politikunterricht,
- Konflikte lassen sich anhand von Kategorien erfassen,
- Konflikte mobilisieren politische Lernprozesse.
(Vgl. KREMB 2010, S. 28).
KREMB, KLAUS (2010): Kompaktwissen Politikdidaktik. Kategorien-Konzeptionen-Kompetenzen. Schwalbach/Ts.: Wochenschau.
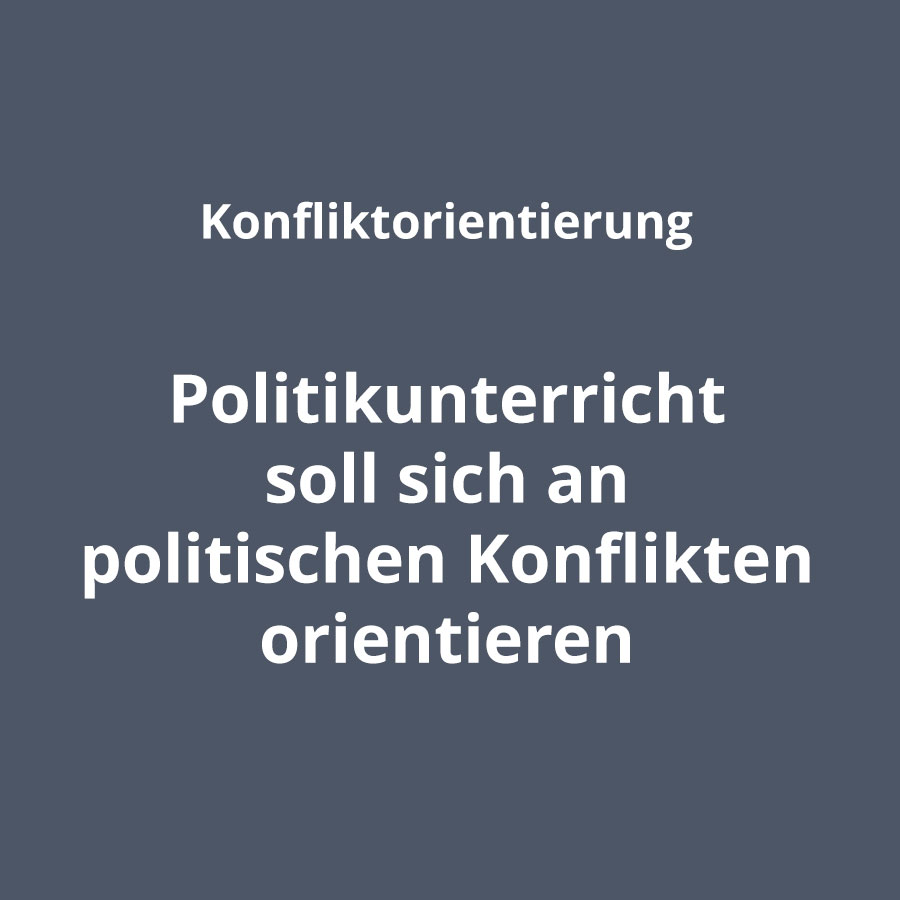
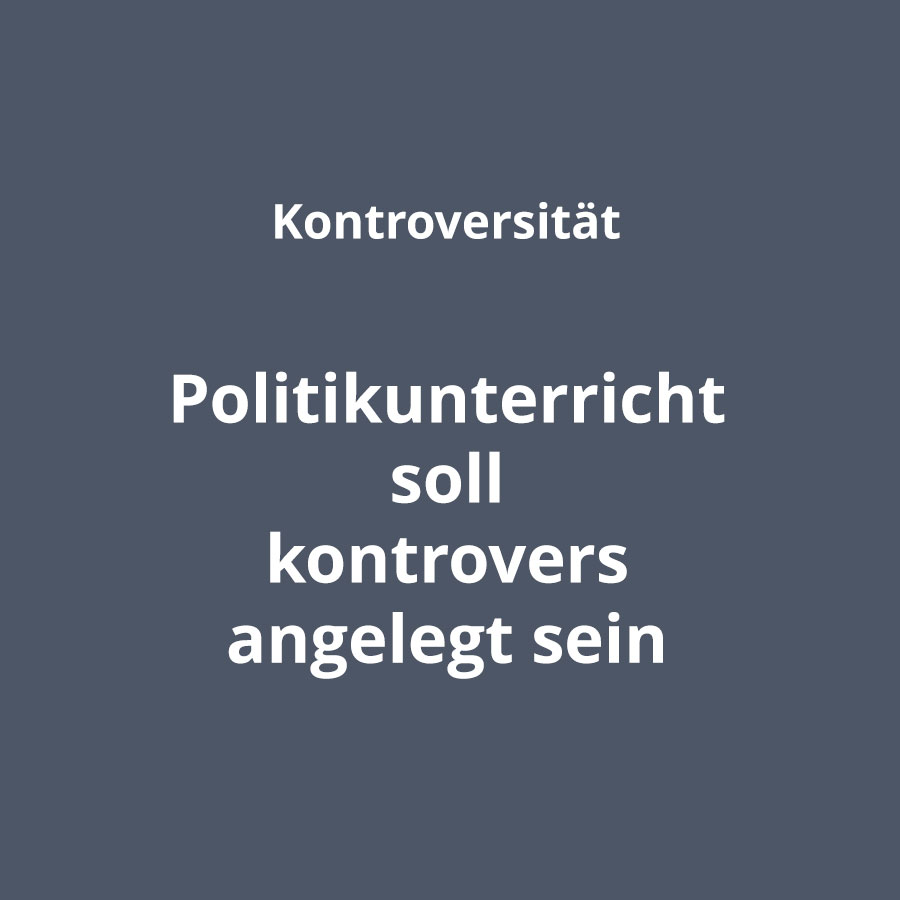
Was bedeutet das?
„Lerngegenstände sollten so ausgewählt und strukturiert werden, dass die kontroverse Struktur des Politischen erkennbar wird.“ (Sander 2008, S. 196)
„Das Prinzip wendet sich damit gegen die „Glättung“ der Lerngegenstände hin zur Vermittlung einer geschönten, heilen Welt. Wie die empirische Unterrichtsforschung weiß, unterliegen jedoch nicht wenige Lehrende einer solchen Versuchung zur Harmonisierung. In der Praxis des Unterrichts kommt es dann zu einem unauffälligen Verschwinden von Kontroversität. So gibt es sublime Kommunikationsmuster der Überwältigung: Lehrende überhören Einwände, harmonisieren Gegensätze und appellieren an das Wahre, Schöne und Gute. [...] Das Kontroversitätsprinzip gehört zum Kern der Berufsethik der in der schulischen politischen Bildung Tätigen. Dahinter steht die Auffassung, dass sich die politische Bildung von dogmatischer parteipolitischer Schulung oder weltanschaulichem Gesinnungsunterricht unterscheiden soll. Offene, aber auch sublime Manipulation durch Unausgewogenheit bzw. Parteilichkeit gilt als schwere Verletzung des pädagogischen Ethos. Dasselbe gilt für den selektiven Umgang mit Wissenschaft, wo nur Belege für vorgefertigte Positionen gesucht werden. (DETJEN 2012, S. 327f.)
DETJEN, JOACHIM (2013): Politische Bildung. Geschichte und Gegenwart in Deutschland. 2. Auflage. München: Oldenbourg. Aus der Reihe: Lehr und Handbücher der Politikwissenschaft.
SANDER, WOLFGANG (2008): Politik entdecken – Freiheit leben. Didaktische Grundlagen politischer Bildung. 3. durchgesehene Auflage. Schwalbach/Ts.: Wochenschau.
Was bedeutet das?
„Problemorientierung heißt, Lerngegenstände danach auszuwählen und zu strukturieren, dass der Kern des Politischen, nämlich das Bearbeiten und Lösen öffentlicher, d.h. politischer Probleme, deutlich wird.“ (Detjen, 2013, S. 329)
Dabei kann einmal zwischen alltäglichen Problemen der unterschiedlichen Politikfelder (Wirtschafts-, Bildungs-, Sicherheitspolitik etc.), epochaltypischen Schlüsselproblemen (ökologische Problematik, Friedensfrage etc.) und dem die gesamte Menschheitsgeschichte begleitende politische Kardinalproblem der Regelung des Zusammenlebens von Menschen in der Gesellschaft, unterschieden werden (vgl. ebd. S. 329).
Politische Probleme zeichnen sich dadurch aus, dass sie einerseits unklar definiert, andererseits hochkomplex sind. Daraus folgt, dass man von den Schülerinnen und Schülern nicht erwarten kann, klar definierte Lösungen zu entwickeln. „Problemorientiertes Lernen heißt in der politischen Bildung daher, Menschen in die Lage zu versetzen, politische Probleme aus unterschiedlichen Perspektiven wahrzunehmen, verschiedene Lösungen durchspielen zu können und sich ein begründetes Urteil über die bestmögliche Lösung zu bilden [...]“ (SANDER, 2008, S. 195).
Folgende Ansprüche sollten Probleme im unterrichtlichen Kontext erfüllen:
- Sie müssen den Charakter der Ernsthaftigkeit aufweisen (nicht fiktiv und nicht als reine Motivationsfunktion),
- Sie müssen aus Sicht der Lernenden als bedeutsam empfunden werden, um Denkanstöße auszulösen,
- Sie müssen politische Lösungen zulassen und keine Katastrophenängste auslösen.
Sind diese Ansprüche erfüllt, kann ein problemorientierter Unterricht die Entwicklung von problemlösendem Denken fördern (Vgl. DETJEN, 2013, S. 330).
DETJEN, JOACHIM (2013): Politische Bildung. Geschichte und Gegenwart in Deutschland. 2. Auflage. München: Oldenbourg. Aus der Reihe: Lehr und Handbücher der Politikwissenschaft.
SANDER, WOLFGANG (2008): Politik entdecken – Freiheit leben. Didaktische Grundlagen politischer Bildung. 3. durchgesehene Auflage. Schwalbach/Ts.: Wochenschau.
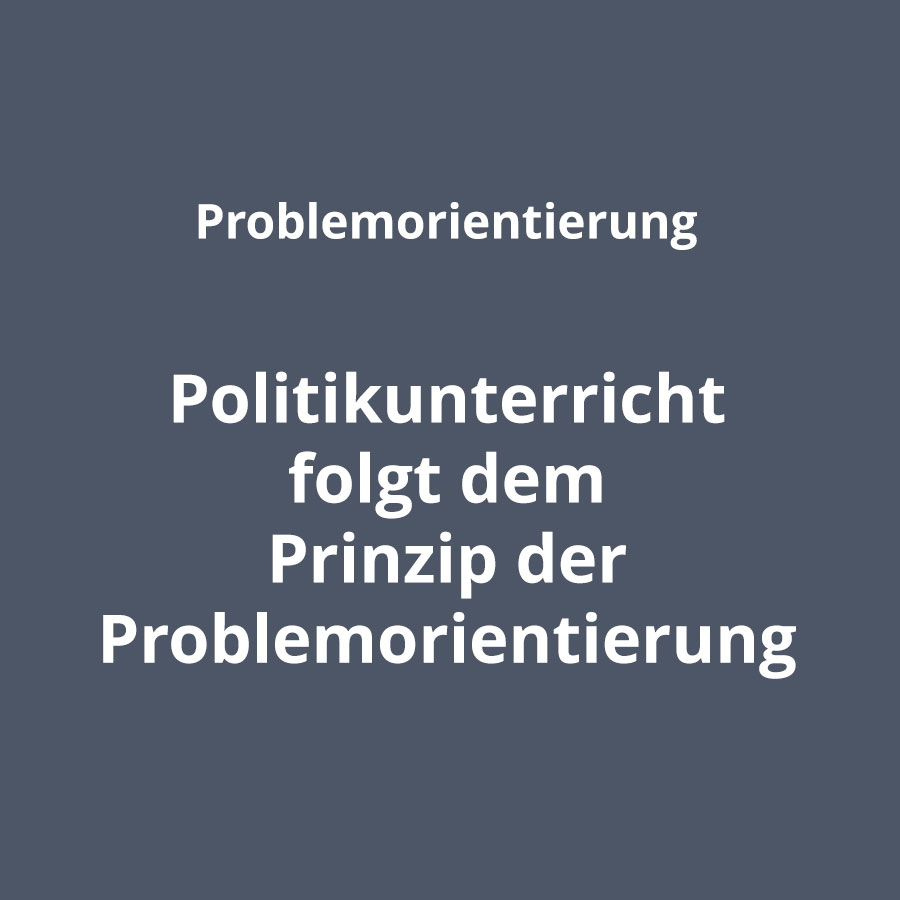
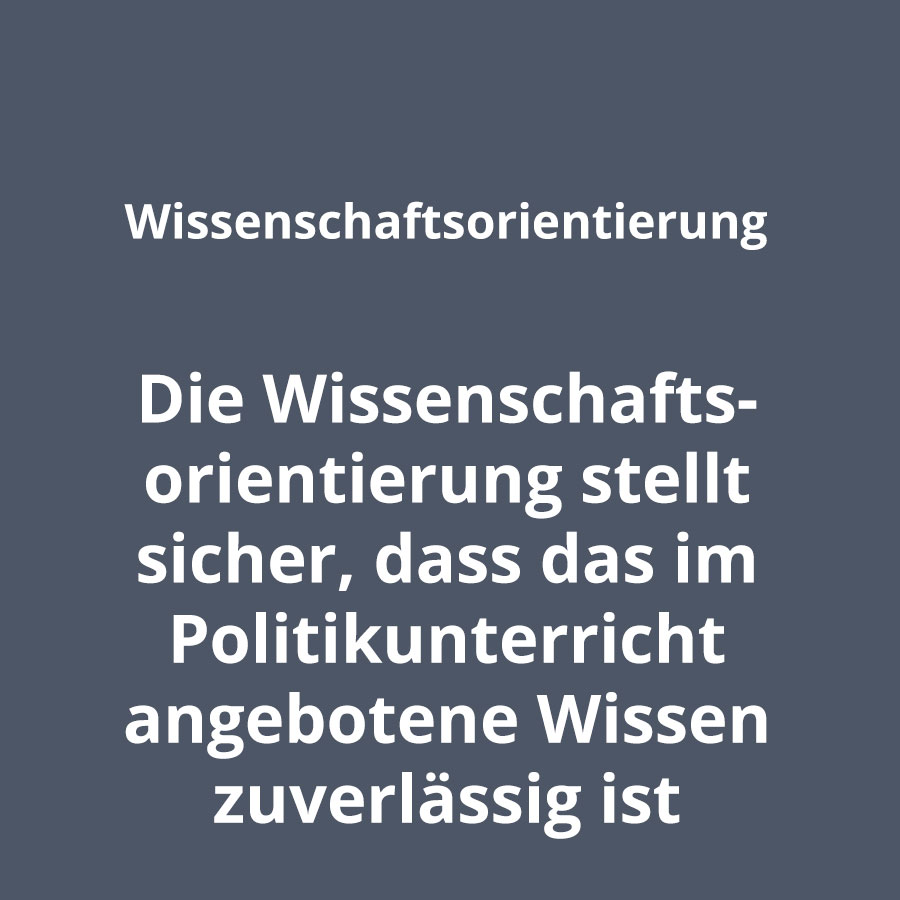
Was bedeutet das?
„Lerngegenstände sollen so thematisiert werden, dass das in der politischen Bildung angebotene Wissen und der methodische Umgang mit ihm vor dem Hintergrund der Sozialwissenschaften verantwortbar ist.“ (Sander 2008, S. 199)
„Wissenschaftsorientierung bedeutet [...] nicht, dass nur wissenschaftliches Wissen Lerngegenstand sein darf. Von bestimmten Lerngelegenheiten in der Sekundarstufe II der Gymnasien abgesehen, fungiert die politische Bildung nämlich nicht als sozialwissenschaftliche Propädeutik. Schließlich ist es auch nicht Aufgabe der politischen Bildung, auf ein sozialwissenschaftliches Studium vorzubereiten.“ (DETJEN 2013, S. 338)
„Die Wissenschaftsorientierung gewährleistet, dass wissenschaftliche Forschungsergebnisse und Theorien zutreffend dargestellt werden. Sie stellt sicher, dass Fachbegriffe richtig gebraucht werden. Sie sorgt dafür, dass keine für das Verständnis eines Gegenstandes wesentlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse ausgeblendet werden. Sie verhindert, dass als widerlegt geltende Tatsachenbehauptungen verbreitet werden.“ (ebd., 338f.) „Wissenschaftsorientierung bedeutet in didaktischer Hinsicht, ein zutreffendes Bild von den Wissenschaften zu vermitteln. So gelten die Wissenschaften zwar als Quelle für die Inhalte und als Maßstab für das Falsche und Richtige, es muss aber vermittelt werden, dass wissenschaftliche Erkenntnisse immer nur relativ und vorläufig gesichertes Wissen hervorbringen. In den Wissenschaften werden häufig unterschiedliche und kontroverse Auffassungen vertreten. Daraus folgt, das wissenschaftlich Umstrittene im Unterricht auch als umstritten darzustellen.“ (ebd., 339)
DETJEN, JOACHIM (2013): Politische Bildung. Geschichte und Gegenwart in Deutschland. 2. Auflage. München: Oldenbourg. Aus der Reihe: Lehr und Handbücher der Politikwissenschaft.
SANDER, WOLFGANG (2008): Politik entdecken – Freiheit leben. Didaktische Grundlagen politischer Bildung. 3. durchgesehene Auflage. Schwalbach/Ts.: Wochenschau.